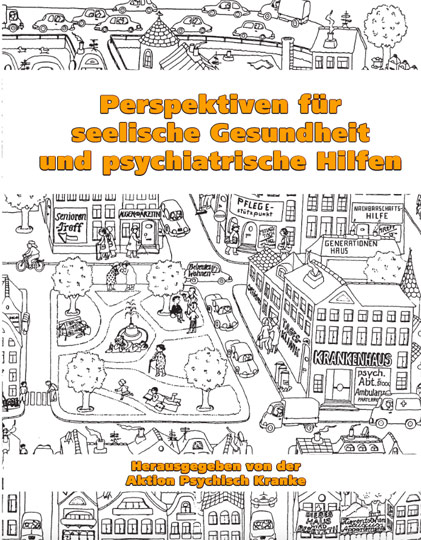
Ich möchte Ihnen aus meiner Sicht skizzieren, warum das Thema Wohnen so bedeutsam ist und warum das eigenverantwortliche Wohnen für uns Psychiatrie-Erfahrene oft so schwer erreichbar ist.
I. Die Bedeutung des Wohnens
Wohnen, was heißt das?
Ist das bloß das Dach über dem Kopf?
Wohnen von althochdeutsch »wonen« (ohne h), bedeutet laut Wikipedia: seinen ständigen Aufenthalt haben, zufrieden sein, die Wohnung sollte als Ort der Geborgenheit, der Zugehörigkeit und der Verwurzelung dienen. In meiner eigenen Wohnung kann ich mich zurückziehen, Abstand zu draußen gewinnen, erholen und auftanken. Hier pflege ich meine sozialen Beziehungen und Freundschaften. Hier ist der intime Mittelpunkt meiner Partnerschaft, Familie und von mir selbst. Hier hat meine Selbstbestimmung und Selbstentfaltung ihr zu Hause.
In einem Zuhause wohnen ist ein bedeutendes und weitreichendes menschliches Grundbedürfnis, bedeutet Schutz, Geborgenheit und Sicherheit.
II. Warum ist das Wohnen jetzt aktuell für uns überhaupt ein Thema?
Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, die meisten Psychiatrie-Erfahrenen leben ja in irgendeiner Form in einer Wohnung und damit wird dieses Grundbedürfnis in Deutschland doch ganz gut gedeckt.
Meine Beobachtung ist eine andere:
Menschen mit psychischen Besonderheiten sind im Vergleich zur Restbevölkerung beim Thema Wohnen in der eigenen Wohnung benachteiligt, müssen sehr viel häufiger in schwierigen Wohnverhältnissen leben und sind häufiger von Wohnungsverlust bedroht oder bereits wohnungslos.
Wohnungslose Menschen:
Statistisch gesehen lebten 2014 335.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Wohnung. Die Prognose bis 2018: bis zu 536.000 wohnungslose Menschen in Deutschland. Man geht davon aus, dass jede zweite bis dritte Person davon behandlungsbedürftig psychisch und/oder suchterkrankt ist. Die Zahl der bedrohten Wohnverhältnisse steigt ebenfalls deutlich an.
Ursachen für die steigende Zahl der Wohnungslosen:
Migration (Völkerwanderung durch Hunger, Krieg), Wohnungsmangel, hohe Mieten, Armut, psychische und/oder Suchterkrankung einhergehend mit sozialpolitischen Fehlentscheidungen.
Menschen mit psychischen Auffälligkeiten in professionell geleiteten Wohnformen:
Trotz intensiver Internetrecherche ist es mir nicht gelungen, verlässliche Zahlen zu dem Thema zu finden, wie viele Menschen mit psychischen Störungen in Deutschland in betreuten Wohngemeinschaften, in vom Träger angemieteten einzelbetreuten Wohnverhältnissen oder in Langzeiteinrichtungen/Heimen leben.
Wie viele dieser Menschen im jeweiligen Wohnumfeld das Wohnen in einer eigenen Wohnung anstreben würden, wenn Sie denn könnten, ist mir auch nicht bekannt. Ich ahne nur, es müssen viele Tausende sein.
III. Derzeitige Ausgangssituation
Seit 2002 gibt es eine Million Sozialwohnungen weniger. Dazu kommt:
- Die Kommunen, die Länder und der Bund verkauf(t)en ihre eigenen Wohnungsbestände meistbietend an private Investoren und haben sich so selbst geeigneter Reserven preiswerten Wohnraums beraubt. Große Wohnungsbestände in attraktiven Lagen stehen wegen Modernisierung den Mieterhaushalten mit geringem Einkommen nicht mehr zur Verfügung.
- Es fehlen mindestens 2,7 Millionen Kleinwohnungen. Dieser Wohnungsmangel, insbesondere bei den kleinen Ein- bis Dreizimmerwohnungen, hat zu einem extremen Anziehen der Mietpreise, insbesondere in den Ballungsgebieten geführt. Der besonders großen Nachfragegruppe der Einpersonenhaushalte (16,4 Millionen Menschen) steht nur ein Angebot von 13,6 Millionen Ein- bis Dreizimmerwohnungen gegenüber.
- Weil ich als Betroffener im Konkurrenzkampf am Wohnungsmarkt aufgrund meiner Einschränkungen, persönlich und finanziell, nicht erfolgreich mitmischen kann, bekomme ich als Psychiatrie-Erfahrener – wenn überhaupt – oft was übrig bleibt, auch schlechte Wohnungen in unzureichenden, entlegenen Umgebungen oder Ghettos.
- Das Thema Wohnung und Existenz (Armut, Überschuldung) ist in vielen Fällen in der psychiatrischen Beratung und Versorgung kein Thema. Betroffene selbst sprechen aufgrund eines verständlichen Schamgefühls nicht über ihre finanzielle Situation. Der drohende Wohnungsverlust könnte bei regelhafter Thematisierung seitens professioneller, psychiatrischer Beratungsstellen oftmals vermieden werden.
Koppelung von Wohn- und Versorgungsleistung: - Oft entsprechen die Wohn- und Betreuungsformen, in denen Psychiatrie-Erfahrene leben müssen nicht den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen.
- So habe ich z. B. in einer Wohngemeinschaft im ambulant betreuten Wohnen gelebt und einen Untermietvertrag mit einem Leistungsanbieter, der quasi Monopolist mit seinem Angebot in der Region war, abschließen müssen.
Der Mietvertrag sah eine Koppelung von Miet- und Betreuungsleistungen vor. Also musste ich Betreuungsleistungen annehmen, als Voraussetzung für meinen Einzug und Verbleib in der Wohngemeinschaft, quasi als Komplexleistung. Das ist auch heute noch gängige Praxis, obwohl durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) Verträge über die Erbringung von Komplexleistungen in Frage gestellt sind. Wenn ich die Betreuungsleistungen nicht mehr will oder brauche, dann muss ich ausziehen. Doch wohin, wenn es kein Wohnungsangebot gibt?
Da bleibt dann nicht mehr viel vom Gefühl der Geborgenheit usw. in den vertrauten vier Wänden. Ich muss »krank« und »unselbständig« bleiben, damit ich weiterwohnen darf. Ich muss die »Zwangsbeheimatung« hinnehmen, obwohl ich doch den Schritt in mehr Selbstverantwortung und Selbständigkeit gehen könnte.
Perspektive Bundesteilhabegesetz
- Mit dem Bundesteilhabegesetz wird die Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgeführt und soll dadurch mehr individuelle Selbstbestimmung ermöglichen. Daher sollen die Fachleistungen der Eingliederungshilfe zukünftig klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt und finanziert werden. Das wäre ein kompletter Systemwechsel.
Denn bis heute sind die Leistungen ganz oder teilweise von der Wohnform (z. B. Wohnung, Wohngemeinschaft oder Einrichtung) abhängig und es muss ein sehr großen Teil des Einkommens und Vermögens von der Person selbst, sowie von dessen (Ehe-) Partner eingesetzt werden. Bis auf ein Schonvermögen von bisher 2.600€, jetzt 5000€. Dadurch kam und kommt es zu einer Entreicherung und einem Abhängigkeitsverhältnis:
Kein Geld – keine Sicherheit – keine eigene Wohnung – keine Selbständigkeit – keine Perspektive – absolute Anpassung an Fremdregeln – Hospitalisierung: Die Möglichkeit, einen Mietvertrag mit Betreuungsleistungen zu koppeln, wird derzeit durch das BTHG nicht eingeschränkt. Es bleibt der Praxis überlassen, wie mit bestehenden Wohn- und Betreuungsverträgen umgegangen wird. Frühestens 2022 ist mit einer Änderung dieser Praxis zu rechnen. Zu befürchten ist, dass diese Änderung in der Praxis erst eintritt, wenn betroffene Psychiatrie-Erfahrene ihr Recht auf eine Entkoppelung von Miet- und Betreuungsvertrag einklagen … - Wenn ich das Glück habe, eine eigene Wohnung zu finden, dann ist diese oft nicht barrierefrei:
Was heißt denn »barrierefrei« für uns Psychiatrie-Erfahrene?
Es ist nicht ganz so einfach, die Entwicklung und Realisierung von Barrierefreiheit und Inklusion in der Praxis im wirklichen Leben des psychisch kranken oder behinderten Betroffenen, zu definieren.
Im Vergleich ist die Inklusion von Menschen mit einer körperlichen Behinderung in den letzten Jahrzehnten deutlicher sichtbar geworden – zum Beispiel gehören Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit zum selbstverständlichen Straßenbild. Ermöglicht wurde dies durch die rollstuhlfahrergerechte Gestaltung von Gehwegen, Zugängen zu Verkehrsmitteln, Gebäuden etc. Frühkindliche Förderung und enorme technische Fortschritte lassen Menschen mit Sinnesbehinderung an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben, von der sie früher ausgeschlossen waren – man denke nur an Gebärdendolmetscher im Fernsehen oder Fußgängerampelpieper.
Noch ziemlich am Anfang steht dagegen die Umsetzung von Teilhabe und Inklusion bei Menschen mit einer psychischen Störung oder Behinderung:
Denn die Barrieren der psychischen Behinderungen sind nicht klar und nicht äußerlich erkennbar. Ich will versuchen, Ihnen ein paar Schlüssel aufzuzeigen, um Hindernisse aus der Sicht von Psychiatrie-Erfahrenen etwas transparenter, bewusster zu machen. Bei uns handelt es sich meist um einstellungsbedingte, emotionale und unsichtbare Barrieren: z. B. Angst vor Stigmatisierung oder Ablehnung in der Nachbarschaft aufgrund meiner Psychiatrie-Biographie.
In meinem Betroffenen-Umfeld beobachte ich eine Zurückhaltung und eine bewusste Entscheidung für Anonymität in der Nachbarschaft wegen der Angst geoutet zu werden, zumal wenn Krankheitsphasen mit Auffälligkeiten verbunden, auftreten.
Weitere mögliche Barrieren (in Kurzform):
- Schwierige Sprache (z. B. Arzt-/Fachsprache);
- Selektive (auswählende, unbewusste) Wahrnehmung;
- Ängste (z. B. Nähe, Kontakt);
- (fehlender, unkalkulierbarer) Antrieb;
- Compliance – Störungsuneinsichtigkeit;
- Symptome (Stimmen) und Nebenwirkungen (von Medikamenten);
- Misstrauen: Schlechte Erfahrungen bis hin zu traumatischen Erlebnissen;
- Armut;
- Selbststigmatisierung.
Die Bedeutung, die Wirkung oder Auswirkung von Barrieren im täglichen Leben der Betroffenen vermag ein Außenstehender oftmals nur zu erahnen. Die Barriere bildenden Blockaden sind schwer erklärbar und begreifbar, wenn diese psychischen Hindernisse nicht selbst erlebt – gespürt werden. Deswegen ist man als Psychiatrie-Erfahrener oft einfach nur sprachlos der Umwelt gegenüber.
Vor kurzem habe ich in den Nachrichten gehört, dass in der Schweiz alle Bahnhöfe in den nächsten Jahren barrierefrei werden sollen.
Wie wäre es, wenn der Begriff der Barrierefreiheit auch auf zwischenmenschliche Barrieren erweitert würde, wenn die Umwelt – auch der Wohnungsmarkt – so gestaltet würde, dass man sich wohl fühlen kann – integriert und inkludiert? Dass man sich öffnen kann, ohne gleich stigmatisiert zu werden. Dann wäre das gemeinsame Leben in der Gesellschaft viel einfacher.
Hilfen zur Gestaltung des nachbarschaftlichen Miteinanders oder Gemeinde-Patenschaften (»Psycho-Paten«) für Neubürger mit Handicaps wären dann selbstverständlich.
Ich setze viel Hoffnung in die »ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung durch Peers, weil dadurch nicht gleich eine »Ver-psychiatrisierung« mit »Ver-behinderung« erfolgt. Weil dadurch vielleicht auch die Besonderheit des individuellen, bedürfnisorientierten Wohnens stärker in den Vordergrund rückt und nicht die psychiatrisch geprägten Ausschlusskriterien bei Erlangung eines Wohnraumberechtigungsscheins im Mittelpunkt stehen. Das wäre für alle Menschen von Bedeutung-


